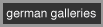german galleries / index cities / index galleries / index artists / index Munich
Haus der KunstPrinzregentenstraße 1
30.04. - 25.07, 2010 Weniger ist mehrBilder, Objekte, Konzepte aus Sammlung und Archiv von Herman und Nicole Daled 1966-1978
"Je déteste le décor" - dieser Ausspruch
von Herman Daled verdeutlicht seine Weigerung, Kunst an die Wand
zu hängen und dadurch als Dekoration zu missbrauchen. Die Ausstellung konzentriert sich ausschließlich auf
die von 1966 bis 1978 angekauften Arbeiten. Sie wird nicht nur
die Werke präsentieren, sondern darüber hinaus die
Genese der Sammlung anhand von akribisch gesammelten und archivierten
Dokumenten beschreiben, die Aktionen oder temporär ausgeführte
Arbeiten belegen. Broodthaers wird zur Schlüsselfigur und zum wichtigsten Künstler der Sammlung; von ihm sind allein an die 80 Werke in der Sammlung. Sein Werk gilt seit den 70er-Jahren in vieler Hinsicht als wegweisend: Er setzt Maßstäbe für eine Kunst, die ihre sozialen Bezüge mit einschließt und den Anspruch "souveräner Eigenständigkeit" von Kunst nicht aufgibt, sondern immer wieder neu erfindet. Der Aufbau der Sammlung verläuft konzentrisch und wird
durch die persönlichen Begegnungen und den Diskurs mit den
Künstlern beeinflusst. Herman Daled vergleicht diese Vorgehensweise
mit einem Jazzliebhaber, der sich nach und nach Schallplatten
kauft. Das Jahr 1969 bringt wichtige Ausstellungen zur konzeptuellen
Kunst, die zu Eckdaten für diese Bewegung werden und von
den Daleds intensiv verfolgt werden. Dazu gehören "Op
losse schroeven: situaties en cryptostructuren" im Stedelijk
Museum, Amsterdam (März/April 1969), "When Attitudes
Become Form. Works - Concepts - Processes - Situations - Information:
Live in Your Head", Kunsthalle Bern u.a. (März/April
1969), und "Konzeption - Conception: Dokumentation einer
heutigen Kunstrichtung", Städtisches Museum, Leverkusen
(Oktober/November 1969). Die 1972 von Harald Szeemann kuratierte
Documenta V führt schließlich mit einer eigenen Abteilung
zur "Weihe" (Herman Daled) der Konzeptkunst. Herman Daled hebt hervor, dass sie zu dieser Zeit einer Bewegung
gegenüberstanden, die noch nichts von ihrer späteren
Bedeutung erkennen ließ. Es war die Phase, in der die Künstler
ihre ersten kreativen Schritte taten. Die Zusammenarbeit zwischen den Daleds und den Künstlern schließt Vereinbarungen ein, die den Erwerb von Werken durch den Sammler als eigenes Projekt unter bestimmte Bedingungen stellt. So kaufen sie Niele Toroni 1969 eine Arbeit ab und erwerben dieselbe Arbeit im Januar 1971 nochmals zu einem Preis, der den gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst ist. 1970 schließen sie mit Daniel Buren einen Vertrag ab. Unter der Bedingung, ein Jahr lang keine anderen Werke zu kaufen, erhalten die Daleds zwölf Monate lang je ein Gemälde - einzige Ausnahme sind Ankäufe von Marcel Broodthaers. Das Projekt wird im Art & Project Bulletin 45 unter dem Titel "a private collector" veröffentlicht. Im gleichen Jahr besucht Herman Daled Lawrence Weiners Ausstellung in der Berliner Galerie Folker Skulima und erwirbt alle drei ausgestellten Arbeiten. Aufgrund des Buren-Vertrags wird der Ankauf jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen. Im Sommer 1971 lässt Daled mit Hilfe des Juristen Michel Claura eine französische Fachübersetzung von Seth Siegelaubs "Artist's Reserved Rights Transfer and Sale Agreement" anfertigen. Der kurz zuvor auf Englisch erschienene Vertrag sichert dem Künstler Rechte auch an bereits verkauften Werken zu. 1972 erwerben Herman und Nicole Daled ein Werk von Ian Wilson, das aus dem Gespräch besteht, das der Künstler mit Herman Daled und Fernand Spillemaeckers am 10. September geführt hat. Zu den vielen Aktivitäten der Daleds zählt unter
anderem die Mitfinanzierung des 1969 in Antwerpen gegründeten
alternativen Ausstellungsraums A 379089. Unter der Leitung von
Kasper König finden dort Ausstellungen und Performances
verschiedener Künstler wie James Lee Byars, Daniel Buren,
Jörg Immendorff, Ben Vautier und La Monte Young statt. Die Sammlung enthält u.v.a. Werkgruppen von Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Hanne Darboven, Jan Dibbets, Robert Filliou, Dan Graham, Douglas Huebler, On Kawara, Sol LeWitt, Niele Toroni und Lawrence Weiner. Obwohl viele monografische und thematische Ausstellungen von Herman und Nicole Daled mit ihren Leihgaben unterstützt wurden, haben sie die Sammlung als solche bisher nie gezeigt. Die einzige umfassende Veröffentlichung erfolgte 2004 im Rahmen der Ausstellung "l'intime, le collectionneur derrière la porte" im Pariser Maison Rouge in Form einer handgeschriebenen Werkliste, die auf einem Sockel präsentiert wurde. Die Ausstellung wird von Ulrich Wilmes und Patrizia Dander kuratiert. Der Katalog erscheint bei Walther König, gestaltet von Walter Nikkels, mit Texten von Birgit Pelzer und Benjamin H. D. Buchloh, ISBN 978-3-86560-763-8. Künstlervortrag von Daniel Buren am Dienstag, den 11. Mai um 20 Uhr (in englischer Sprache)
Sammlung Goetz im Haus der Kunst Podiumsbesetzung 1993 legte Ingvild Goetz mit dem Ankauf von Cheryl Donegan, "Untitled (Head)" (1993) den Grundstein für ihre Sammlung von künstlerischen Videos und Filmen. Heute ist diese Sammlung europaweit die bedeutendste ihrer Art. Mit inzwischen 480 Werken von ca. 170 Künstlern bietet sie einen repräsentativen Querschnitt durch das zeitgenössische Kunstschaffen in den Bereichen Film und Video. Zu den Künstlern, die dort vertreten sind, gehören u. a. Doug Aitken, Chantal Akerman, Matthew Barney, Janet Cardiff / George Bures Miller, Nathalie Djurberg, Stan Douglas, Harun Farocki, Omer Fast, Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Rodney Graham, Teresa Hubbard / Alexander Birchler, Mike Kelley, William Kentridge, Sharon Lockhart, Steve McQueen, Ulrike Ottinger, Paul Pfeiffer, Pipilotti Rist, Anri Sala, Fiona Tan, Gillian Wearing und Yang Fudong. Ingvild Goetz hat diese Sammlung längst auch für das Publikum geöffnet - durch wechselnde Ausstellungen in ihrem eigenen Museum und durch wiederholte Kooperationen z.B. mit dem ZKM in Karlsruhe. Ab Februar 2011 bis mindestens 2014 zeigt die Sammlung Goetz nun einen Teil ihrer Filme und Videos im Haus der Kunst. Die Inhalte dieser Dauerausstellung werden zwei- bis dreimal im Jahr wechseln. Durch diese Dauerausstellung wird die Sammlung Goetz der Öffentlichkeit in noch größerem Umfang zugänglich. Die Teams von Haus der Kunst und Sammlung Goetz freuen sich,
mit dieser Vereinbarung auch ein neues Modell der Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Institution und Privatsammlung vorzustellen:
Das Haus der Kunst stellt für die Dauerausstellung 14 kabinettartige Räume im Luftschutzkeller des Hauses zur Verfügung. Die Errichtung dieses Luftschutzkellers wurde vom Architekten Paul Ludwig Troost schon mit dem Bau des Hauses der Deutschen Kunst 1933/37 projektiert - eine der ersten staatlichen Maßnahmen, mit denen Hitler unmittelbar nach seiner Machtergreifung die Bevölkerung auf einen kommenden Krieg vorbereiten wollte. Der Luftschutzkeller hat eine Fläche von 292 qm, seine Raumfolge ist symmetrisch. Ein eigener Eingang führt direkt vom Parkplatz / Englischen Garten dorthin. |
||