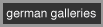sgerman galleries / index cities / index galleries / index artists / index Bochum
Museum Bochum
Kortumstrasse 147
44787 Bochum
Tel. 0234 - 516 00 18; Fax 0234 - 516 00 10
E-mail: museum@bochum.de
Di, Do, Fr, Sa 11 -17 Uhr, Mi 11 - 20 Uhr, So 11 - 18 Uhr
Freier Eintritt. Jeden 1. Mittwoch im Monat
www.bochum.de/museum
aktuelle Ausstellung / current exhibition
vorausgegangene Ausstellung
/ previous exhibition
01.07. - 30.09.2001
In Holz geschnitten
Dürer, Gauguin, Penck und die anderen
Im Zeitalter der Kommunikationstechnologien verändern sich
Wahrnehmung und Bewußtsein des Individuums rasant. Informationen
werden digitalisiert und in gleichsam unsichtbarer Gestalt per
Internet oder Satellit auf den Weg gebracht, um sich damit dem
unmittelbaren Zugriff von Sender und Empfänger zu entziehen.
Vor dem Hintergrund dieser in ihren Auswirkungen noch nicht abzusehenden
Prozesse wird die älteste Drucktechnik als Ausdrucksmittel
in ihrer Aktualität und Vielseitigkeit wieder entdeckt.
Zeitgenössische Künstler wie A.R. Penck, Georg Baselitz, Günther Förg, Richard Serra oder Donald Judd umspielen die Schnittstellen von Malerei, Graphik und Skulptur, spitzen die künstlerischen Gattungen in ihrer Gegensätzlichkeit zu und brechen diese in der Grenzverletzung schließlich auf. Sie greifen verschiedene Traditionslinien auf, um diese dann aufzulösen, Kategorien aufzubrechen und Perspektiven zu eröffnen, die weit über den historischen Horizont des Holzschnitts hinaus ragen.
Die Erfindung des Holzschnitts steht an der Epochenschwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Zwar wird der Fortbestand als Mittel zur Reproduktion von Bildern und Texten mehrfach durch technische Innovationen - Radieung, Kupferstich, Lithografie, Fotografie - in Frage gestellt. Doch bis in die Gegenwart vollzieht sich seine Entwicklung in immer neuen Schüben der Wiederentdeckung.
In der Ausstellung ist der zeitgenössische Blickwinkel als Ausgangspunkt vorausgesetzt. Vorgeführt wird ein Panorama der aktuellen Szene in ihrer Vielschichtigkeit und Offenheit. Daß diese innovativen, die traditionelle Kunstauffassung bisweilen provozierenden Bildformen aus der Geschichte dieses Mediums herleitbar sind, will die Ausstellung anschaulich vor Augen führen. So wird der Betrachter denn auch zu kolorierten Einblattdrucken aus dem 15. Jahrhundert geleitet, die der Verbreitung von Glaubensinhalten dienten. Von Albrecht Dürer erstmals in seiner Eigenwertigkeit als Ausdrucksmedium erkannt, befreit sich der Holzschnitt über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart schrittweise von jeder außerkünstlerischen Indienstnahme. Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach d.Ä., Hans Burgkmair und Hans Süss von Kulmbach reizen in der Folge Dürers die Gestaltungsmöglichkeiten des Holzschnitts bis zum Extrem aus, um diesem im Verfahren des Clairobscur (Tondruckverfahren) neue, bildhafte Qualitäten abzugewinnen. Werke von Ugo da Carpi, Nicolo Boldrini und Andrea Andreani belegen parallele Entwicklungen in Italien. Blätter von Christoffel Jegher nach Gemälden von Rubens stehen für eine letzte Blütezeit im 17. Jahrhundert, bevor der Holzschnitt zeitweise durch die Radierung verdrängt wird. Eine erste Wiederentdeckung des Holzschnitts vollzieht sich im 19. Jahrhundert durch die Künstler der Romantik, Caspar David Friedrich und Alfred Rethel, die im ästhetischen Rückgriff auf die Dürerzeit eine verklärte Vergangenheit aufleben lassen und gleichzeitig eine kulturelle und gesellschaftliche Erneuerung anzubahnen suchen. In England rücken die Künstler der Arts and Crafts-Bewegung - Edward Burne-Jones und William Morris - den Holzschnitt in das Zentrum ihres Programms einer Versöhnung von angewandter und freier Kunst. Die Begegnung des Westens mit dem japanischen Farbholzschnitt bereitet schließlich dem Symbolismus und dem Jugendstil den Weg (Emil Orlik, Peter Behrens, Felix Vallotton). Am Ende des geschichtlichen Bilderbogens stehen als Wegbereiter einer umfassenden Renaissance im 20. Jahrhundert Werke von Paul Gauguin und Edvard Munch.
Einen weiteren Teil der Ausstellung eröffnen die Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts, die dem Holzschnitt die Funktion eines bildhaften Manifestes zuerkannten. Künstler des Expressionismus, der "Brücke" und des "Blauen Reiter" (Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein, Otto Müller, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Christian Rohlfs, Wassily Kandinsky, Franz Marc, Johannes Molzahn) nutzen den handwerklichen Charakter des Verfahrens im Sinne einer subjektiv gefärbten Ausdruckskraft, um den akademischen Kanon zu überwinden und den Betrachter für die Ursprünge von Kunst und Leben zu sensibilisieren. Die Verfechter einer revolutionären Tendenzkunst - Gerd Arntz, Conrad Felixmüller, Käthe Kollwitz, Frans Masereel, Franz M. Jansen, Reinhard Schmidthagen - nehmen seine ursprüngliche propagandistische Funktion auf und finden so eine Möglichkeit, eine plakativ zugespitzte Bildsprache auszuformen und über die massenhafte Verbreitung der Bilder direkt in gesellschaftliche Prozesse einzugreifen. Auch im Spannungsfeld von Abstraktion und Konkretion behauptet der Holzschnitt einen neuen Stellenwert. Künstler aus dem Umfeld von Bauhaus und Konstruktivismus - Josef Albers, Otto Freundlich, Franticek Kupka, Walter Dexel, Hans Arp - akzentuieren die Oberflächenstruktur des Holzes, die Reaktion der Farbe und den Druckstock in seiner Objekthaftigkeit, um so die Gestaltung und deren Mittel in das Zentrum ihrer Untersuchungen zu stellen. Bei einigen Künstlern gewinnt der Druckstock eine skulpturale Eigenständigkeit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird sowohl in der Bundesrepublik (HAP Grieshaber, Hans Arp, Julius Bissier) als auch in der DDR (Wolfgang Mattheuer, Karl Georg Hirsch) versucht, die ästhetischen Möglichkeiten des Holzschnitts der Weimarer Jahre aufzugreifen. Zeitgenössische Positionen reflektieren zwar den traditionellen Bezug des Verfahrens, doch es brechen sich wie in einem Brennspiegel gerade auch aktuelle Interessen. Aufgeworfen werden hierbei Möglichkeiten einer figurativen bzw. narrativen Bildsprache (Asger Jorn, Georg Baselitz, Per Kirkeby, Roy Lichtenstein, Friedemann Hahn, Felix Droese, Claudia Blume, Gustav Kluge), die Konzeption des Bildes als Zeichen, als Spur oder Piktogramm (Gerhard Altenbourg, Josef Beuys, A.R. Penck, Christoph Loos, Uwe Meier-Weitmar, Martin Noël, Bogdan Hoffmann) sowie Prinzipien einer seriellen Ordnung bis hin zur raumgreifenden Inszenierung (Günther Förg, Franz Gertsch, Donald Judd, Hubert Kiecol). Es entfaltet sich ein Panorama, in dem sich generell die künstlerischen Tendenzen seit Beginn der 80er Jahre zwar widerspiegeln, hierbei jedoch ungewohnte, neue Facetten offenbaren.
Zur Ausstellung erscheint im Wienand-Verlag, Köln, ein
umfangreicher Katalog mit wissenschaftlichen Beiträgen von
Dr. Claus Baumann (Leipzig), Dr. Bernd Finkeldey (Düsseldorf),
Dr. Hans Günter Golinski (Bochum), Sepp Hiekisch-Picard
(Bochum), Dr. René Hirner (Heidenheim a.d. Brenz), Dr.
Christoph Kivelitz (Bochum), Prof. Reinhart Schleier (Bochum)
und Dr. Hans Martin Schmidt (Bonn), einem umfassenden Bildteil
und Biographien der über 100 vorgestellten Künstler.
Eröffnung am 11.07.2001
Begrüßung Ernst-Otto Stüber, Oberbürgermeister der Stadt Bochum
Einführung Dr. Hans Günter goinski, Museumsleiter
Musikalisches Rahmenprogramm
Es spielen die Alphorn-Philharmoniker
Martin Janasch
Harry Keilwerth
Rainer Stark
Edgar Wehle